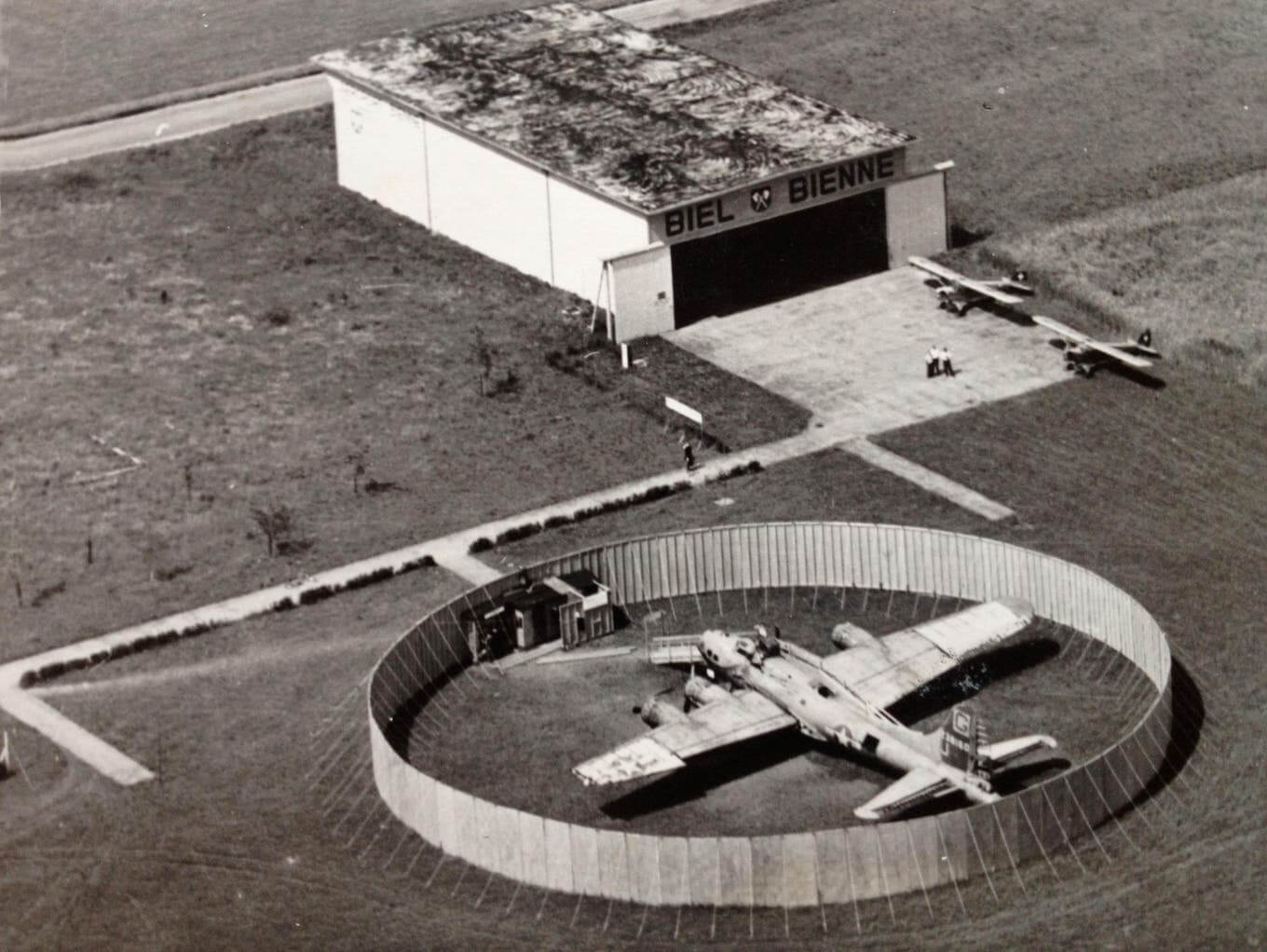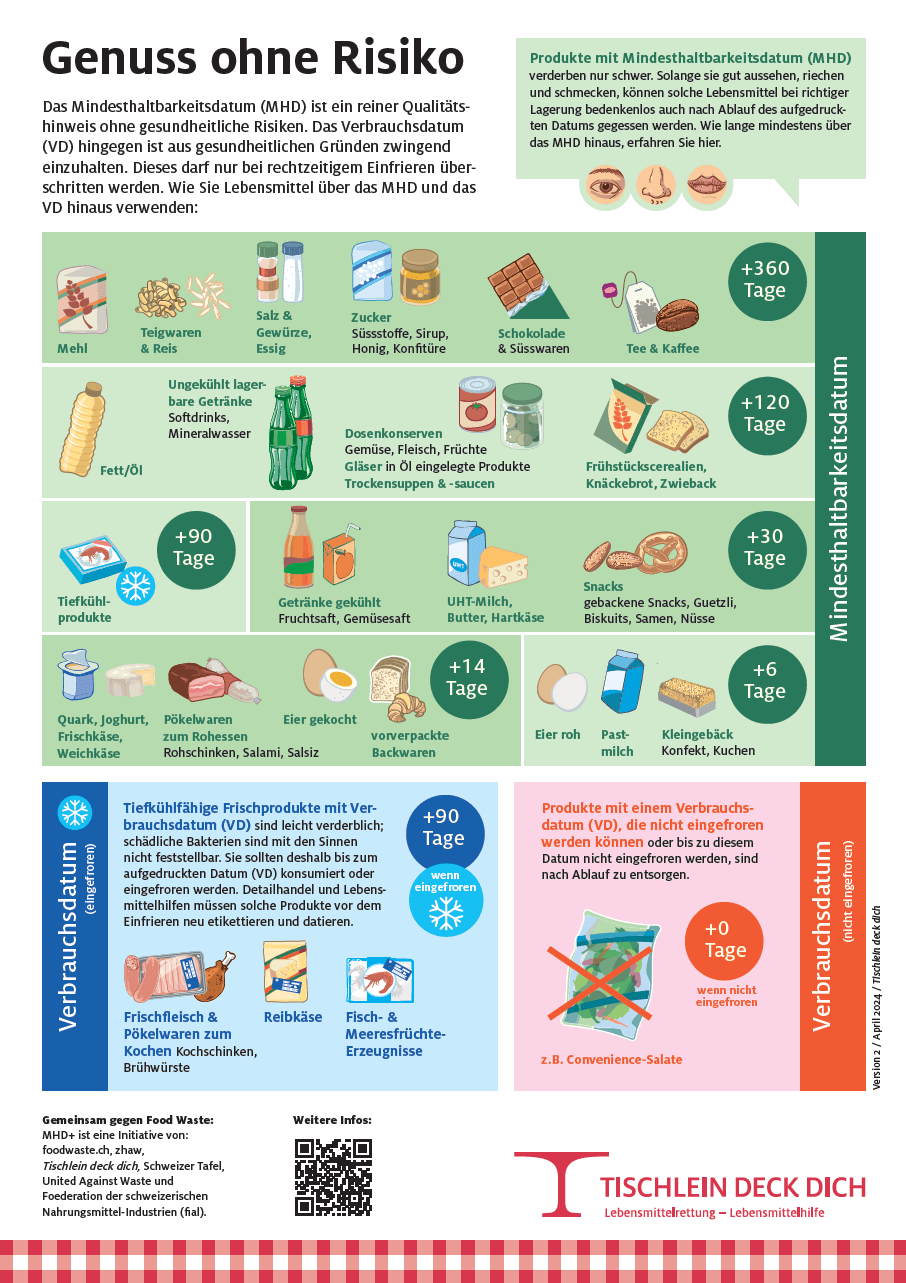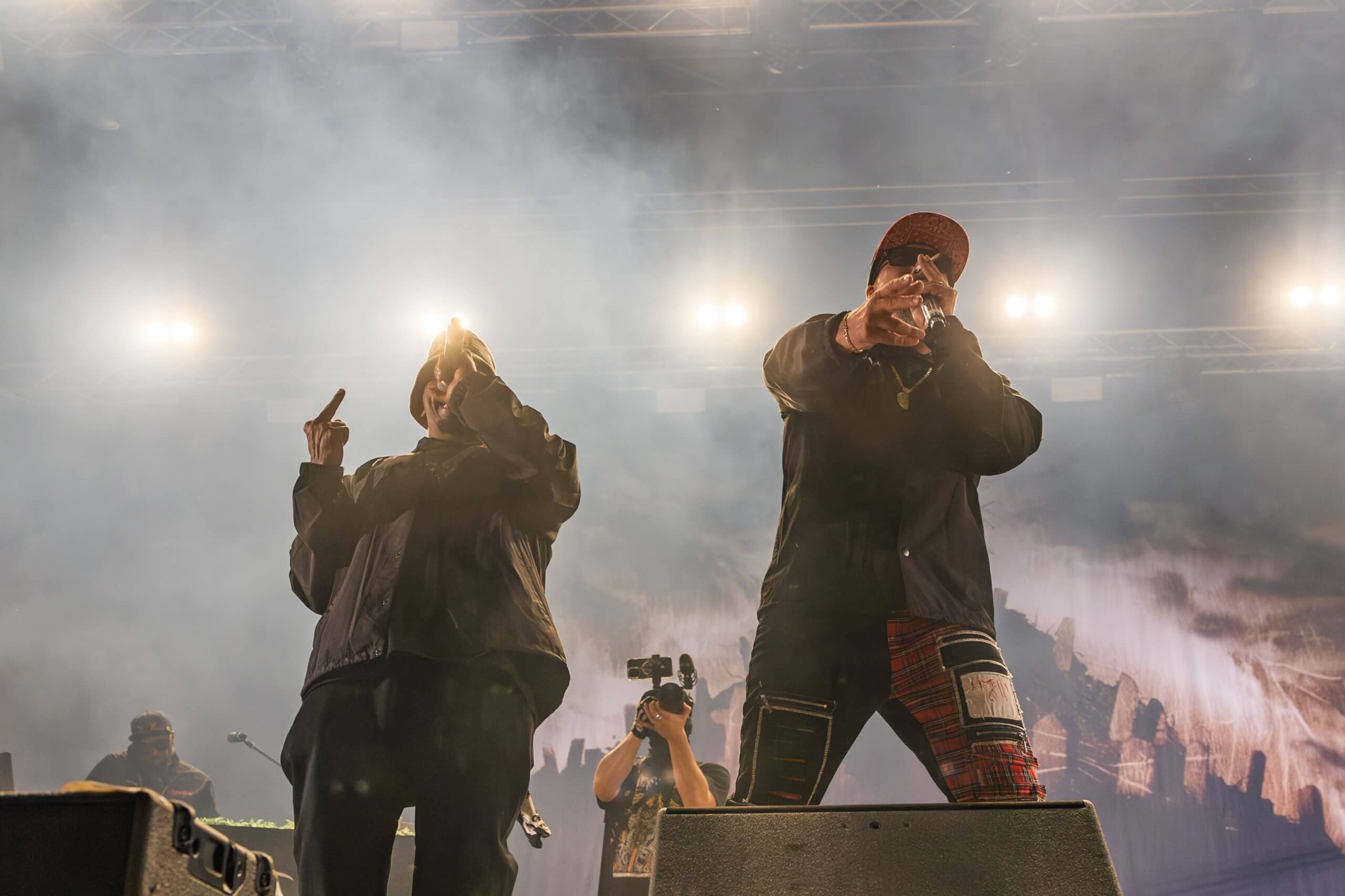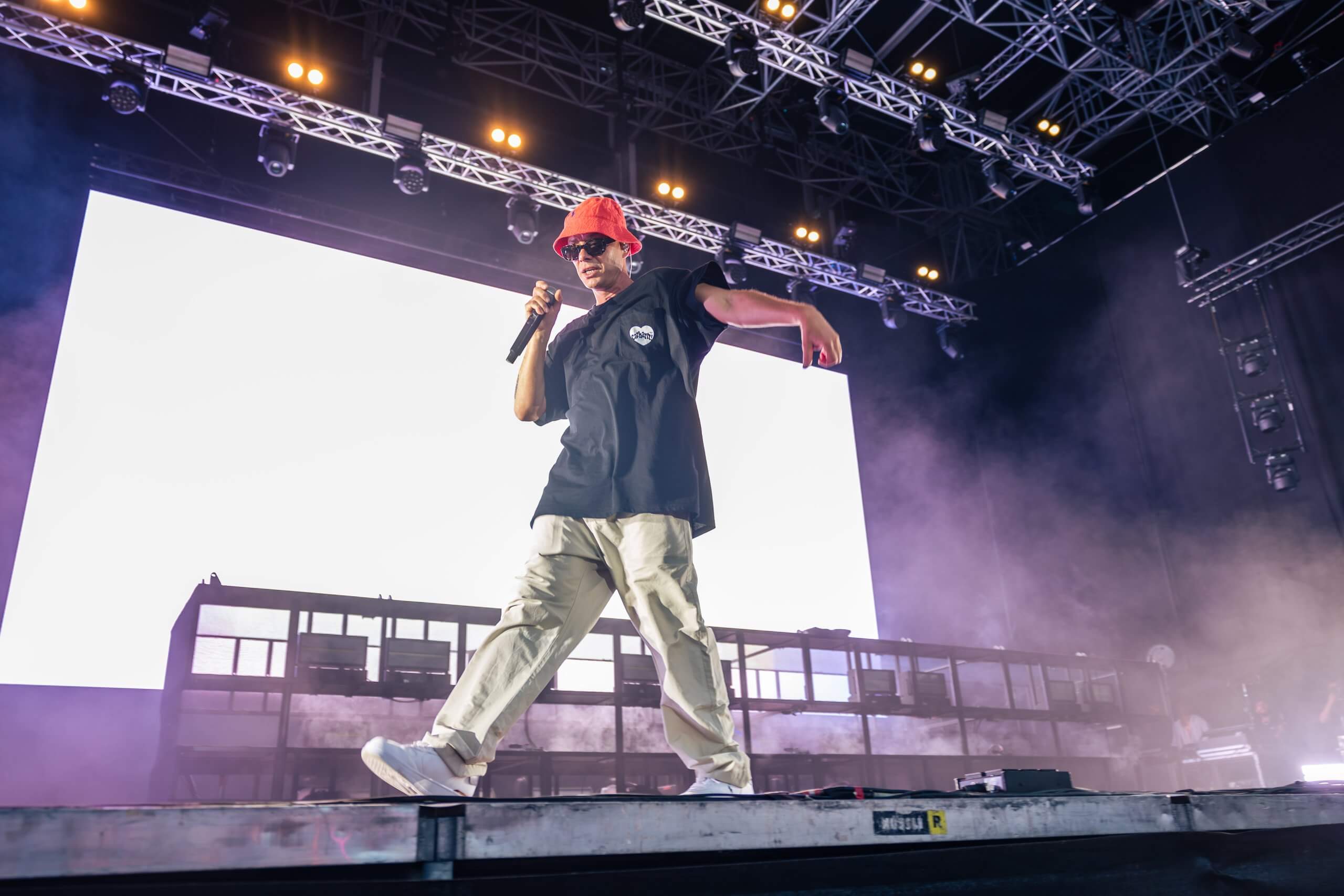Wer am Donnerstagabend bei den Bieler Stadien war, konnte meinen, der EHC Biel befinde sich noch immer in den Playoffs. In Scharen füllten die Menschen Busse und strömten um die Tissot Arena. Und das, obschon die erste Mannschaft sich bereits in die Ferien verabschieden musste. Denn: Das U20-Team spielt noch und hatte das erste Playoff-Finalspiel in der höchsten Schweizer Juniorenliga.
In der Tissot Arena – der Eintritt war frei – sammelten sich die Menschen vor allem auf der Nordtribüne, gegenüber der Spielerbank. Die Sitzplätze waren beinahe vollständig besetzt und auch in der Kurve fanden sich über 100 Fans. In den Katakomben sammeln sich die Bieler Nachwuchsspieler, von denen einige regelmässig in der National League zum Einsatz kamen oder in der Swiss League Stammspieler waren. Sie sind bereit und befeuern einander mit Schlachtrufen. Als sie aufs Eis treten, werden sie mit Applaus begrüsst, wie er sonst in der Juniorenliga selten sein dürfte: 2817 Fans waren im Stadion.

Schon in der ersten Minute geht es zur Sache, Biel verbucht die erste grosse Chance, Zürich kontert und das Tor kann nur dank des Einsatzes eines Bieler Verteidigers verhindert werden. Wenige Sekunden später muss Biel-Torhüter Florian Scheu dennoch ein erstes Mal hinter sich greifen: Kimo Gruber erzielt das 1:0 für die Gäste.
Biel zu Beginn in Rücklage
Es war sicher nicht der Start, den sich die fast 3000 Fans in der Tissot Arena erhofft hätten – und auch die Bieler Nachwuchsspieler nicht. Diese fangen sich aber schnell und finden immer besser ins Spiel. Obschon Zürich in der Startphase die bessere Mannschaft ist, kommen die Seeländer immer wieder zu Chancen.

Es ist richtige Playoff-Stimmung, es kommt immer wieder zu Handgemengen, sobald die Partie unterbrochen ist. Und auch die Ränge geben sich keine Blösse und feuern die Bieler lautstark an. Darin findet man vor allem eingefleischte EHCB-Fans, die praktisch keinen Match der ersten Mannschaft verpassen. Aber auch einige Neulinge gibt es, die zum ersten Mal an einem Eishockeymatch sind und die kostenfreie Gelegenheit ergriffen haben.
Und sie sind nicht vergebens gekommen: Biels Jamie Villard zieht Richtung Tor, gibt an Livio Christen auf der Aussenbahn ab. Dieser kann dann nicht zurückpassen, weil Villard von der Zürcher Verteidigung gestoppt wird. Er versucht dann den Abschluss auf gut Glück aus scheinbar unmöglichem Winkel – und trifft die Torumrandung am weiteren Pfosten, die Scheibe prallt ins Tor ab.
Vieles erinnert an ein Spiel der «Grossen»
Biel geht in Führung mit einem Distanzschuss von Tommaso Madaschi nach einem Pass von Mark Sever. Die Seeländer spielen zunehmend aufmüpfiger und mutiger, was dem Publikum sichtlich gefällt: Es ist voll dabei.
In den Pausen ist so ziemlich alles wie bei einem Heimspiel – zumindest auf der Nordseite der Tissot Arena. Dort sind die Essens- und Getränkestände offen, man drängt sich durch Menschenschlangen, auf den Treppen der Notausgänge quetschen sich die Menschen zusammen, um zu rauchen. Auf der sonst ebenso belebten Südseite herrscht allerdings gespenstische Stille.
Nach der ersten Pause kommt Zürich sortierter zurück und schiesst bald den Ausgleich. Doch Biel schaltet sogleich einen Gang höher und kontert wenig später mit einem sehenswerten Treffer, erneut von Tommaso Madaschi.

Und er kann später sogar noch einen drauflegen: Im letzten Drittel zieht er nach einem sehenswerten Zusammenspiel aufs Tor und schiesst gar den Hattrick. Zürich ist mit zwei Toren Rückstand jetzt gefordert. Die Stimmung im Stadion ist ausgelassen, die Fans auf den Sitzplätzen klatschen immer wieder zu den Chören, die auf der Tribune Sud die Mannschaft anfeuern.

Bieler Goalie gefordert
Aber auch die Lions können brandgefährlich werden: Wenn das Zusammenspiel passt, wie in der 32. Minute. Der Bieler Goalie Scheu ist geschlagen und die Scheibe liegt frei vor dem offenen Tor. Die Bieler Verteidiger können die Scheibe mit Ach und Krach aus dem Slot spielen.
Allgemein spielt Torhüter Scheu stark und zeigt mehrere Glanzparaden, die die Fans immer wieder mit Szenenapplaus goutieren. Und die rund 150 Fans auf der Tribune Sud stärken ihrem Goalie im Mitteldrittel mit lautstarken Gesängen den Rücken. Vier Minuten vor Schluss des Mitteldrittels braucht es Scheu nochmals, als ein Zürcher allein vor dem Tor steht. Doch der Bieler Torhüter bleibt souverän.

Sogar das Spiel, dass die Kurve «HCB» ruft und die Sitzplätze denselben Ruf zurückrufen, funktioniert: Es geht ein paarmal hin und her wie beim Tennis, die Kurve bedankt sich mit Applaus und beginnt gleich noch einmal.
Standing Ovations schon lange vor dem Schlusspfiff
Und obschon die Lions versuchen, Druck zu machen, ziehen sich die Bieler nicht zurück und kommen weiter zu guten Chancen. Vor dem eigenen Tor verteidigen die Seeländer konsequent und lassen keine heiklen Szenen mehr zu.
Schon zwei Minuten vor Spielende stehen praktisch alle Fans im Stadion und feuern die Bieler bis zum Schlusspfiff an. Auch als die Lions 38 Sekunden vor Schluss noch den Anschlusstreffer erzielen, schadet das der Stimmung nicht. Schliesslich geht das Spiel 4:3 zu Ende – und die Arena ist schon beinahe am Kochen, als der Schiedsrichter die Partie abpfeift.

Wie es sich gehört, bedanken sich auch die Nachwuchsspieler bei den Fans und setzen sich erstmals gemeinsam mit der Tribune Sud hin, lassen sich feiern.

Die Partie erinnerte an ein Meisterschaftsspiel in der National League der «Grossen», sowohl die Stimmung als auch die Qualität des Spiels waren über dem Niveau der Swiss League. Biel war besser, aber nicht deutlich. Aber genau das machte es zu einem besonders sehenswerten Spiel, bei dem hochkarätiges Eishockey gezeigt wurde.
Weiter geht es mit dem nächsten Finalspiel am Sonntag in der Swiss Life Arena in Zürich und am Mittwoch mit dem nächsten Heimspiel in der Tissot Arena – und vielleicht dann auch schon dem letzten Spiel der Saison.
Telegramm
EHC Biel Spirit – GCK Lions
4:3 (2:1 / 1:1 / 1:1)
Tore: 1:08 Kim Gruber 0:1, 9:56 Livio Christen 1:1, 17:27 Tommaso Madaschi 2:1, 21:45 Noel Berner 2:2, 22:44 Tommaso Madaschi 3:2, 45:11 Tommaso Madaschi 4:2, 59:22 Milan Hadorn 4:3
Tissot Arena Biel, 2817 Zuschauerinnen und Zuschauer.
Aufstellungen
EHC Biel
Tor: Florian Scheu, Louis Wehrli
Verteidigung: Niklas Blessing, Rodwin Dionicio; Gaël Christe, Ramon Trauffer; Jonathan Moser, Joel Kurt; Finn Bichsel, Liors Solomoncuks
Sturm: Guillaume Käser, Noé Tarchini, Nolan Cattin; Livio Christen, Jonah Neuenschwander, Jamie Cillard (C); Lorin Froidevaux, Mattheo Reinhard, Manuel von Rohr; Mark Sever, Sven Stekoffer, Tommaso Madaschi.
GCK Lions
Tor: David Brodecky, Janosch Hrdina
Verteidigung: Nino Niedermann, Laurin Schmucki; Yann Voegeli, Filippo Schmid; Noel Ulrich, Niklas Wegmüller; Morgan Henderson
Sturm: Alessandro Segafredo, Noah Böhler, Livio Truog; Yannik Ponzetto, Kimo Gruber, Daniel Olsson; Lenn Zehnder, Endo Meier, Noel Berner; Lauro Peter, Niels Schläfli, Laurin Jakob.